

Der deutsche Rap ist uninteressant geworden. Zwischen Lelele- und Lalala-Lappen, hypermaskulinen Pseudo-Gangstern und dem x-ten Kollegah-Abklatsch (nicht, dass das Original so erstrebenswert wäre…) flattern nur noch wenige Künstler durchs Bild, die ich ernst nehmen kann. Umso besser also, wenn der Rapper nicht im Geringsten ernst genommen werden will. Ich präsentiere: Gay Butters, der schwule Stern am Rap-Firmament und selbsternannter „fatherfucking Dildoking“ („Dildoking“) – die Ehre eurer Mütter ist sicher, jetzt muss Papa dran glauben!
Nein, das ist kein Witz. Während ich einen Rotten Monkey oder Prezident auf intellektueller Ebene vergöttere (siehe meine bisherigen Lobeshymnen), gibt es niemanden, der mein Bedürfnis nach beklopptem Scheiß so befriedigt wie Gay Butters. Zugegeben, technisch ist er keine Kanone – keine weltklasse Lyrik, kein mörderischer Flow. Aber das macht er mit einem Haufen Humor und seinem genialen Image wett.
Besagtes Image besteht daraus, dass er den stereotypen Deutschrapper (heterosexueller Macho mit dicker Karre und einem Schiffscontainer voll halbnackter Frauen) bravourös konterkariert: Der Mann mit pinkem Tank-Top und Iron Man-Maske gibt sich aggressiv homosexuell, dreht mit Absicht unprofessionelle Musikvideos und pflegt eine „Mir ist scheißegal, wie lächerlich ich mich mache“-Einstellung. Zur Hölle, der Kerl rennt in einem Penis-Kostüm über öffentliche Plätze (oder ohne Kostüm an der Polizeistation vorbei) und rappt auf einen Hakuna Matata-Beat. Er will einfach seinen Spaß haben, und ich liebe es.

Wobei, stimmt nicht ganz. Hier und da findet man in seinen Texten unter tausend ironischen Schichten eine tiefere Aussage. So behandelt „Tanz am Strand“ auf … sagen wir eigene Art, Themen wie Rassismus und Klassenunterschiede, während uns Butters auf „Dildoking“ seine Motivation verrät: Er erachtet deutsche Rapper als „einfallslos [mit ihren] Texten über irgendwelche Fot*en“, weshalb er sich berufen fühlt „etwas Abwechslung [reinzubringen] in diese Welt voller Poser“. Und wenn das heißt, den „pink gestylte[n] Homo“ („Geistige Ergüsse“) zu spielen, dann wird das gemacht. Also, falls ihr mal einen Abend nichts zu tun habt, gebt auf YouTube „Gay Butters“ ein und lehnt euch zurück. Bitte.

Achtung! Der folgende Podcast ist nichts für schwache Nerven, sondern vor allem für diejenigen, die schon immer wissen wollten, mit was sich Rechtsmediziner*innen den ganzen Tag beschäftigen. Wusstet ihr beispielsweise, dass Wasserleichen nicht immer direkt an die Oberfläche schwimmen, sondern im Winter teilweise mehrere Monate auf dem Grund „überwintern“? Oder, dass Rechtsmediziner nicht immer nur Leichen im Sektionssaal untersuchen, sondern mindestens genauso häufig lebendige Opfer von Gewalttaten?
Diesen Fragen widmen sich Philipp Eins und Dr. Michael Tsokos in ihrem Podcast „Die Zeichen des Todes“, der einmal im Monat erscheint. Der Journalist und der bekannte deutsche Rechtsmediziner treffen sich hierfür im Institut der Rechtsmedizin der Berliner Charité und rollen die verschiedensten rechtsmedizinischen Fälle der Vergangenheit von hinten auf. Im Podcast geht es aber weniger um die Dramaturgie eines Mordes oder darum eine Story möglichst spannend aufzubereiten. Vielmehr steht die Ursachenforschung

am menschlichen Körper im Vordergrund, was manchmal mehr und manchmal auch weniger erschreckend ist als zuvor vermutet. Das Gespräch zwischen Eins und Dr. Tsokos wird gelegentlich von kleinen, nachgesprochenen Szenen unterbrochen, die den behandelten Fall noch einmal Stück für Stück zusammenfassen. Das trägt aber nicht nur zum besseren Verständnis bei, sondern bietet oft eine willkommene Verschnaufpause bei besonders schlimmen Fällen.
Den Podcast gibt es unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, deezer und allen anderen gängigen Podcastanbietern. Mein spezieller Tipp ist die Folge „Das Skelett auf der Rückbank“. Wenn ihr nach dem Podcast aber noch nicht genug von Tsokos und seinen Fällen habt, empfehle ich sein gleichnamiges Buch „Die Zeichen des Todes“ (2017) oder auch einen Blick auf sein Instagram-Profil @dr.tsokos (Aber Achtung: Hier gibt es oft sehr detaillierte Bilder seiner Arbeit).

Es ist kaum zu glauben, dass solch kleine Kreaturen wie Bienen der Gesellschaft so viel Nutzen bringen können und manchmal sogar die Menschheit retten. In dem Roman “Die Geschichte der Bienen” geht es um drei Familien, die in verschiedenen Jahrhunderten leben. Diese Familien haben aber einiges gemeinsam: Ihre Geschichten sind mit Bienen verbunden.

Eine Geschichte beginnt im Jahr 1852 in England. Der Biologe William Savage liegt tagelang im Bett, denn er ist davon überzeugt, dass er als Forscher gescheitert ist. Eines Tages erfindet er einen Bienenstock und versucht seine Idee in der Realität umzusetzen.
Eine andere Geschichte spielt in der Gegenwart (eigentlich schon in der Vergangenheit für uns im Jahr 2021), im Jahr 2007 in den USA. Der Imker George Savage besitzt eine “Bienenfarm”. Er will, dass sein Sohn seine Tätigkeit übernimmt. Der Sohn will aber ein Journalist werden. Dann aber verschwinden die Bienen… Wie läuft seine Arbeit jetzt weiter?
Die letzte bzw. dritte Handlungslinie spielt in der Zukunft, im Jahr 2098 in China: Die Bienen scheinen ausgestorben zu sein. Die Heldin Tao, die als Bestäuberin arbeitet, wird mit einem großen Problem in ihrer Familie konfrontiert und versucht dieses zu lösen.

Als Bloggerin unter dem Namen @luiseliebt (guckt doch mal auf ihrem Profil vorbei!) hat Marie Luise Ritter bereits früh angefangen zu schreiben und sich spätestens nach dem Erfolg ihres ersten Buches „Tinder Stories – Ein Jahr voller Dates“ einen Namen als Autorin gemacht. Ich muss zugeben, dass ich anfangs etwas skeptisch war, scheint es doch gerade für viele Influencer_innen Trend zu sein, ein Buch zu schreiben. Doch ich wurde nicht enttäuscht – „Vom Nichts suchen und Alles finden – Notizen über die Liebe“ ist wirklich eines: authentisch. Ritters Stil lässt sich nur schwer einem Genre zuordnen und kann als eine Mischung aus Biographie, Blog, Roman und ja, vielleicht Lebensratgeber beschrieben werden. Vorsicht, mit Lebensratgeber meine ich nicht, dass sie versucht, den / die Leser_in zu belehren – nein, das ganz und gar nicht. Vielmehr lässt sie einen einfach an ihren Erfahrungen und Erlebnissen teilhaben.
„Irgendwas sucht jeder. Aber wenn man sagt, dass der Weg das Ziel ist, ist dann die Suche das Finden und nicht das Finden das Finden? Ist die Suche nach etwas im Leben das, was uns beschäftigt, lebendig hält?“ (M. L. Ritter, S. 107).
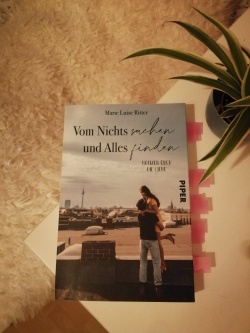
Die Texte zu lesen, fühlt sich ein kleines bisschen wie Urlaub mit einer guten Freundin an. Marie Luise Ritter teilt ihre Gedanken über Rastlosigkeit, Beziehungen und das Leben, vor allem über die Liebe und nimmt den/die Leser_in mit auf Reisen, durch ihren Alltag in Berlin und Hamburg und rein in Diskussionen mit ihren Freundinnen. Und dabei ist sie witzig, nachdenklich und schonungslos ehrlich. Es macht Freude, sich mit auf ihre Gedankenreisen zu begeben, zu grübeln und zu lachen, denn auch trotz manch melancholischer Grübeleien gibt sie einem eines mit auf den Weg: Hoffnung. Darauf, dass das Leben es gut mit uns meint und dass Liebe immer irgendwo auf uns wartet – vielleicht nicht unbedingt im nächsten Tinder Date, aber vielleicht in dem Gespräch mit Freunden, einer Reise, Begegnungen mit fremden Menschen. Oder einfach in uns selbst.
Ein Buch, das man auch immer mal wieder in die Hand nehmen und für Inspirationen und ein bisschen Lebensfreude durchblättern kann! Noch ein kleiner Medientipp on top: Auch ihre wöchentliche „Großstadtkolumne“ finde ich sehr lesenswert – sie passt sonntags immer hervorragend zu einem Kaffee und gemütlichen Start in den Tag. Ihr findet sie hier.
